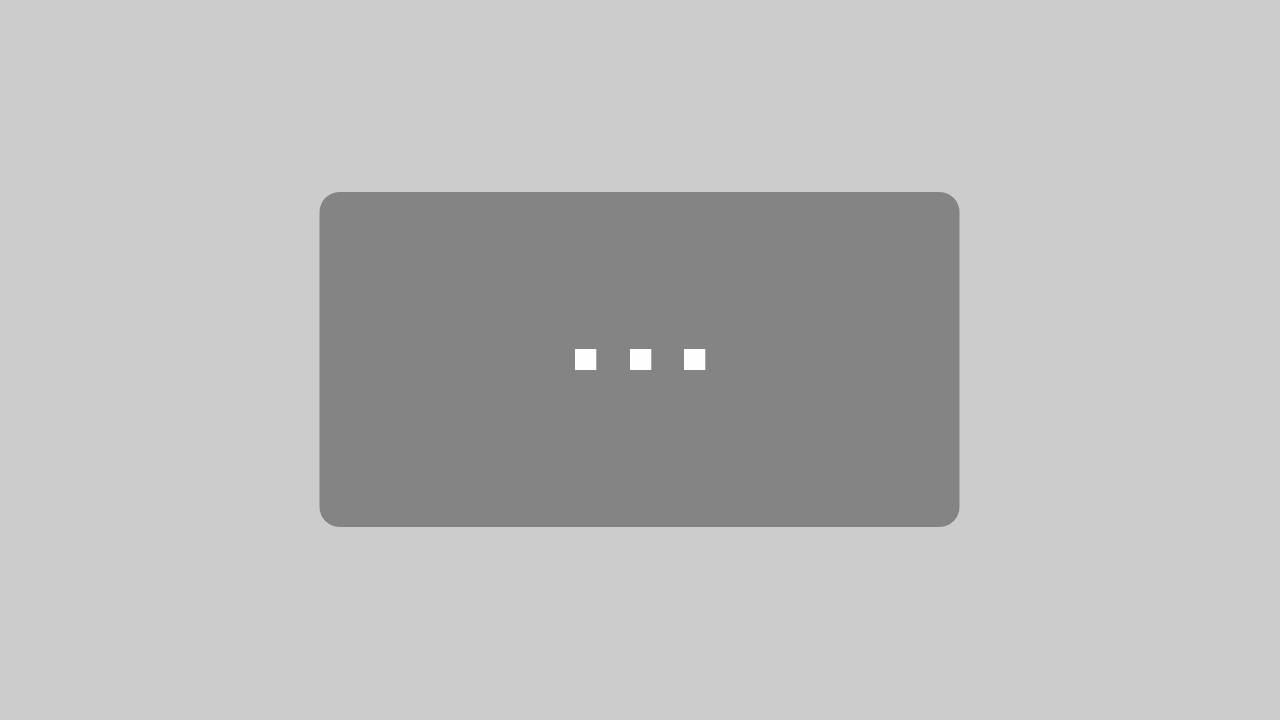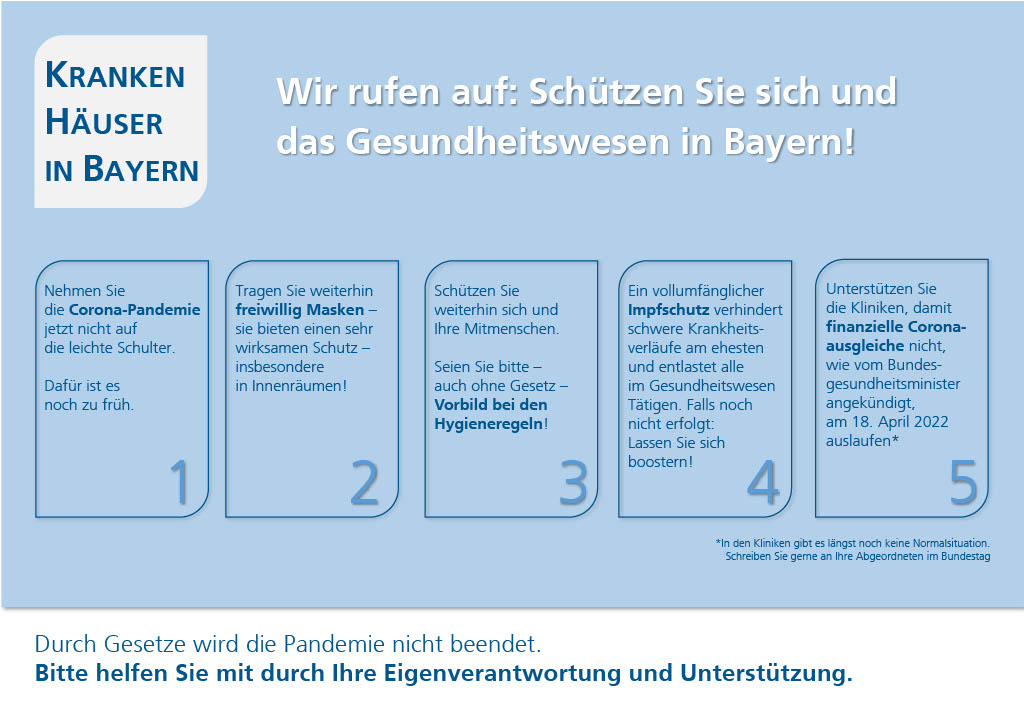Nürnberg, 9. Nov. 2021 – Gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Emmert von der Universität Bayreuth hat Prof. Dr. Oliver Schöffski vom Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg die Methodik des Klinikchecks entworfen und wertet mit seinem Team jährlich die Informationen von rund 50 Krankenhäusern in und um Nürnberg aus. Das sind Daten, die deutsche Krankenhäuser verpflichtend dokumentieren müssen und die vom Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) erhoben werden. Außerdem gehen anonyme AOK-Routine-Daten in die Bewertung mit ein sowie Fallzahlen und Patientenbewertungen der Weissen Liste. www.weisse-liste.de
Detailinformationen zum Projekt finden sich hier: https://www.gm.rw.fau.de/forschung/projekte/laufende-projekte/qualitaetsberichterstattung/
Wöchentlich berichten die Nürnberger Zeitung – und seit diesem Jahr – die Nürnberger Nachrichten, Nordbayerischen Nachrichten und www.nordbayern.de über das Ranking der 14 verschiedenen Leistungsbereiche vom Kniegelenkersatz bis zur Geburtshilfe.
Die Behandlungsqualität des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz wurde in zehn Leistungsbereichen bewertet: Kniegelenkersatz, Gallenblasenentfernung, Herzkatheter, Brustkrebsbehandlung, künstliches Hüftgelenk, Leistenhernie, gynäkologische Operationen, Herzschrittmacher, Behandlung einer Lungenentzündung und Geburtshilfe.
Die Sprecherin des Klinikums, Franka Struve, sprach mit Prof. Dr. Oliver Schöffski:
Franka Struve: Nach welchen Kriterien werden die Leistungsbereiche oder die Indikationen ausgewählt?
Prof. Dr. Oliver Schöffski: Wir haben die Zielsetzung, Patienten in Kliniken zu steuern, in denen sie für ihre Indikation bestmöglich versorgt werden. Und deshalb ist ein wichtiges Auswahlkriterium, dass eine Maßnahme im Krankenhaus planbar sein muss. Es nützt nichts, wenn ich einen Notfall, wie z.B. einen Schlaganfall habe und es wichtig ist, dass ich schnell überhaupt eine Klinik erreiche und ich auch keinen Einfluss auf die Auswahl einer Klinik habe. Planbare Maßnahmen sind zum Beispiel eine Hüftendoprothese (künstliches Hüftgelenk), eine Geburt oder die Behandlung eines Mammakarzinoms (Brustkrebs). Hier hat der Patient mehrere Wochen, manchmal sogar Monate Zeit zu überlegen: Welches ist das Krankenhaus, in das ich gehen möchte? Das erste Auswahlkriterium ist also die Planbarkeit, das zweite Kriterium ist die Wählbarkeit. Wählbarkeit bedeutet, dass es in der Region eine Auswahl geben muss. Wenn eine Maßnahme oder eine bestimmte Operation nur in einer einzigen Klinik im Umkreis von 50 Kilometern durchgeführt werden, hat man keine Chance eine Auswahl zu treffen. Es muss eine Konkurrenz zwischen Krankenhäusern geben bezüglich der einzelnen Maßnahmen, die dort vorgenommen werden.
Hat sich die Auswahl der Indikationen im Lauf der Zeit geändert?
Es gibt einen leichten Wandel, der allerdings nicht so sehr von uns abhängt, sondern von den Vorgaben der gesetzlichen Qualitätssicherung von IQTIG – Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Das Institut fragt nicht in jedem Jahr die gleichen Indikationen ab und daran orientieren wir uns. Wo wir keine Daten vorliegen haben, können wir keine Auswertung vornehmen, nichtsdestotrotz gibt es ab und zu mal etwas Neues, wie das Hygienemanagement.
Welche Schlussfolgerungen kann der medizinische Laie ziehen, wenn dem Krankenhaus eine unauffällige Qualität und das Erreichen des Zielkorridors bescheinigt wird?
Die Krankenhäuser sind verpflichtet jährlich bestimmte Qualitätsinformationen an das IQTIG zu melden. Dort werden diese Informationen gesammelt, aggregiert und es wird ein Bereich festgelegt, in dem etwas unauffällig ist. Wenn bei einer bestimmten Operation es unauffällig ist, wenn zwischen 85 und 95 Prozent der Patienten keine Zweitoperation benötigen und das Krankenhaus hat Daten in diesem Bereich, dann ist es unauffällig. Wenn man allerdings plötzlich sieht, dass nur in 70 Prozent der Fälle eine weitere Operation nicht notwendig ist, dann ist man eben auffällig. Diese Auffälligkeit hat etwas mit nicht optimaler Qualität zu tun. Kurz gesagt: Je mehr und je häufiger bei den bestimmten Indikatoren ein Leistungserbringer unauffällig ist, desto besser.
Die Fallzahlen spielen auch eine Rolle für die Reihung innerhalb einer Gruppe. Das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz kann in der Geburtshilfe nie auf Platz eins stehen, weil es zahlenmäßig auf 800 Geburten pro Jahr begrenzt ist. Hat sich im Laufe Ihrer Untersuchungen die Idee verstetigt, dass eine höhere Fallzahl mit einer besseren Qualität einhergeht?
Das Klinikum Forchheim kann mit einer geringeren Fallzahl nur dann nicht auf Platz eins stehen, wenn es Kliniken mit mehr Fällen gibt, die bezüglich der Indikatoren genauso gut abschneiden. Bezüglich der Fallzahlen zeigt ein Blick in die Literatur: Je häufiger eine Operation durchgeführt wird, desto höher ist die Qualität. Diese Aussage kann am oberen Ende irgendwann kippen, wenn ‚Fließbandmedizin‘ praktiziert wird, aber im Großen und Ganzen ist dieser Zusammenhang für die meisten Indikationen nachgewiesen. Übrigens ermutigen wir bei unseren Schlussfolgerungen nicht dazu, nur das Krankenhaus auf Platz eins aufzusuchen, sondern wir sagen, dass alle Krankenhäuser im grünen Bereich gleichwertig gut sind und eine Qualität quasi nachgewiesen haben. Rein kapazitätsmäßig wird es gar nicht funktionieren, dass in einem Haus sämtliche Geburten stattfinden. Von daher ist diese Anzahl der sogenannten Prozeduren, also die Anzahl der Geburten, bei uns kein erstrangiges Kriterium, sondern nur ein weiteres, um innerhalb der einzelnen (farblich gekennzeichneten) Gruppen zu differenzieren. Ob man im grünen Bereich an erster, zweiter oder dritter Stelle ist, das hängt von den Fallzahlen ab.
Beim Klinikcheck handelt es sich nicht um einen Vergleich, sondern um eine Bewertung. Könnte es theoretisch sein, dass alle Krankenhäuser im grünen Bereich sind?
Genau, es ist eine absolute Bewertung, keine relative Bewertung. Das bedeutet, dass es nicht immer Kliniken im roten oder gelben Bereich geben muss. Alle betrachteten Kliniken können im grünen Bereich sein, wenn sie eine unauffällige Qualität nachweisen. Wenn alle Geburtshilfen im grünen Bereich sind, wird innerhalb des Bereichs nach Patientenzufriedenheit, Empfehlungsrate und der Anzahl der Prozeduren, die durchgeführt werden, differenziert.
Verwenden Sie die Qualitätsberichte, die beim G-BA (G-BA, Gemeinsamer Bundesausschuss, das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen), eingereicht werden, oder auch die von den Kliniken selbst veröffentliche Qualitätsberichte?
Wir verwenden ausschließlich die Daten aus Quellen, von denen wir annehmen, dass die Daten dort qualitätsgesichert sind, und das sind in erster Linie die G-BA Daten, die dem IQTIG gemeldet werden. Die zweite wichtige Quelle sind die AOK-Routinedaten, wenn sie für die entsprechende Indikation vorhanden sind.
Softwareprogramme, z. B. GeDoWin, helfen den Kliniken Indikatoren, die einen Qualitätssicherungsbogen auslösen, Revue passieren zu lassen, bevor diese Daten das Haus verlassen. Inwieweit können Krankenhäuser ihre Qualitätsberichte mittels Qualitätssicherungsmonitoring optimieren?
Ja, das können sie, aber das ist nicht unser Ziel! Wir verfolgen zwei Ziele: Wir wollen erstens eine ‚Abstimmung mit Füßen‘ erreichen, das heißt, wir hoffen, dass Patienten sich Kliniken aussuchen, die in unserem Ranking tendenziell weit oben stehen. Die anderen Kliniken werden dann merken, dass plötzlich weniger Patienten kommen und werden sich überlegen, woran das liegt, und werden – so unsere Hoffnung – versuchen ihre Qualität zu verbessern. Infolgedessen werden Qualitätssicherungsmaßnahmen eingeführt, damit das Krankenhaus in den nächsten Jahren in den Rankings besser abschneidet. Das ist unser zweites Ziel: Qualitätsverbesserungen in den Kliniken.
Technische Optimierungen, die dafür sorgen, dass ein Haus im Ranking einen höheren Platz erreicht, sind nicht unser Ziel. Es gibt kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um im Ranking besser abzuschneiden, ohne aber die Qualität wirklich zu verbessern.
Wenn man mit Beratungsunternehmen über Marketingmaßnahmen von Krankenhäusern spricht, ist viel die Rede von Einweiser-Marketing, also von der Bewerbung von niedergelassenen Ärzten, die einen Patienten in ein Krankenhaus überweisen. Hat der Klinikcheck auch diese Zielgruppe im Visier?
Im Rahmen unserer großen Befragungen haben wir zum Beispiel bei allen Orthopäden in Nürnberg nachgehakt, inwieweit sie das Ranking überhaupt zur Kenntnis nehmen. Erstens, wissen sie von dem Klinikcheck? Und zweitens, wenn ja, bauen sie es in ihre Entscheidungsfindung ein? Wenn sie es einbauen, verwenden sie dann eher die positiven Informationen, das heißt, sie empfehlen eine gut gerankte Klinik, oder die negativen, das heißt, sie raten vom Besuch einer schlecht gerankten Klinik ab? In den letzten Jahren haben wir nur in einer der beiden großen Nürnberger Zeitschriften, die einen Marktanteil von rund zehn Prozent hat, die Ergebnisse des Klinikchecks veröffentlicht. Da war der Bekanntheitsgrad bei den niedergelassenen Ärzten nicht allzu hoch. Wir gehen davon aus, dass der Klinikcheck in den nächsten Jahren deutlich bekannter sein wird, da wir jetzt ein zehn Mal so großes Verbreitungsgebiet durch die Einbeziehung der zweiten großen Nürnberger Zeitung haben. Einige Ärzte beziehen die Ergebnisse des Klinikchecks in die Empfehlung für die Patienten teilweise mit ein, allerdings noch nicht in dem Ausmaß, wie es sein könnte.
Wie hat sich das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz entwickelt?
Es hat sich sehr gut entwickelt. In diesem Jahr haben wir zum sechsten Mal das Ranking durchgeführt und man sieht eine sehr deutliche Tendenz von der allerersten Erhebung, die 2016 durchgeführt wurde, bis zum heutigen Zeitpunkt, dass die Platzierung des Klinikums Forchheim innerhalb dieser sechs Jahre deutlich besser geworden ist. Dominierten in der Anfangszeit eher die schlechteren Platzierungen, ist man jetzt fast durchgängig in den Spitzengruppen vertreten. Generell kann man sagen: das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz ist besser geworden, woran auch immer das liegt, vielleicht ein wenig an den Anreizen, die unser Klinik-Check setzt.
Aufgrund der Coronapandemie werden die Fallzahlen vermutlich einbrechen oder zurückgehen. Wie wirkt sich das auf die Bewertung aus?
Unsere Zahlen hinken immer eineinhalb bis zwei Jahre dem aktuellen Geschehen hinterher. Bereits die Kliniken liefern Vergangenheitsdaten. Ehe diese dann gesichtet werden und Rücksprache genommen wird, ehe die Daten bei uns landen und ausgewertet werden, vergehen in der Regel eineinhalb bis zwei Jahre. Wenn die Coronapandemie sich auf die Fallzahlen niederschlägt und diese zurückgehen, ist das für unser Ranking kein Problem, weil wir die Fallzahlen in ‚oberes Drittel‘, ‚mittleres Drittel‘ und ‚unteres Drittel‘ unterteilen. Wenn sich Corona bei allen Häusern gleichmäßig auswirkt, hätte man keine Unterschiede. Es kommt nur zu Verschiebungen, wenn die Maximalversorger vielleicht gar keine Hüftendoprothesen mehr machen, weil hier sämtliche Betten für Corona gebraucht werden, und das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz hat keine oder wenig Corona-Patienten und führt nur noch Hüftendoprothesen-Operationen durch. Wie gesagt, die Fallzahlen sind nachrangig. Die wichtigsten Daten sind die Qualitätsindikatoren, die vom IQTIG ausgewertet werden.
Methode – am Beispiel der Auswertung ‚Einsetzen eines Hüftgelenkersatzes‘
Beim Einsetzen eines Hüftgelenkersatz existieren zwei Hauptdatenquellen für unser Ranking: Die Daten der gesetzlichen Qualitätssicherung (IQTIG) und Daten aus den AOK Routinedaten. Zwei Datenquellen ermöglichen eine bessere Differenzierung als eine. Wenn die Hüftendoprothese in einem Klinikum sowohl beim IQTIG als auch bei der AOK in der Spitzengruppe gelistet wird, also im oberen Drittel, dann wird diese Leistung im Klinikcheck dem grünen Bereich zugeordnet: Spitze plus Spitze ist insgesamt Spitze. Wenn die Daten aus einem der beiden Quellen auffällig sind, also Spitze plus zweiter Platz oder zweiter Platz plus Spitze, rangiert dieser Leistungsbereich bei unserem Ranking in der zweiten Gruppe im hellen Grün. Mittels eines Algorithmus wird ein Leistungsbereich je nach Kombination einer der fünf Gruppen zugewiesen. Bei der Hüftendoprothese können fünf Cluster unterschieden werden mit den Farben Dunkelgrün, Hellgrün, Gelb, Orange und Rot. Wenn nur Daten vom IQTIG vorhanden sind, ist die Einteilung gröber in ‚oberes Drittel‘, ‚mittleres Drittel‘ und ‚unteres Drittel‘.
Im nächsten Schritt erfolgt die Sortierung innerhalb einer Gruppe. Dazu werden die Fallzahlen herangezogen und nach Größe absteigend geordnet. Platz 1 und 2 innerhalb einer Gruppe sind noch fast gleichwertig, ebenso die mittleren Plätze 3 und 4 und die unteren Plätze, im Beispiel Platz 5 und 6. Im letzten Schritt legt die Patientenweiterempfehlungsrate den endgültigen Platz fest. Die Patientenempfehlungen müssen dabei abteilungsbezogen sein, sich nicht auf das gesamte Krankenhaus beziehen.
Welche vom IQTIG generierten Daten werden für den Klinikcheck herangezogen?
Die Krankenhäuser sind verpflichtet, je nach Indikation bestimmte Kennzahlen zu liefern. Beim Einsetzen eines Hüftgelenkersatz ist das zum Beispiel die Wieder-Operationsrate, die Sturzprophylaxe oder die Komplikationsrate. Für das Ranking haben wir im vergangenen Jahr sechs Indikatoren aufgenommen. Es wird überprüft, ob die Werte der Qualitätsindikatoren im unauffälligen Bereich liegen. Wenn man bei allen Indikatoren unauffällig ist, spricht das für eine hohe Behandlungsqualität und es erfolgt eine Eingruppierung in die Spitzengruppe.
Wer legt die Indikatoren fest?
Die Indikatoren, die die Kliniken an das IQTIG liefern, sind gesetzlich vorgegeben und von zuständigen Fachgesellschaften als relevant befunden worden. Allerdings wird diese Relevanz bei einigen Indikatoren kritisch diskutiert. Dieses Problem können wir als Gesundheitsökonomen nicht lösen, sondern müssen es an die Ärzteschaft zurückspielen. Hier muss ein Konsens gefunden werden, welche Indikatoren relevant sind und erhoben werden sollten.